

Hinweis für Smartphone-Nutzer: Diese Website läßt sich am besten auf einem großen Bildschirm betrachten und lesen. Sie können auch Ihr Smartphone um 90° drehen.
Smartphone users please note: This website is best seen on a big screen — or turn your smartphone by 90°.
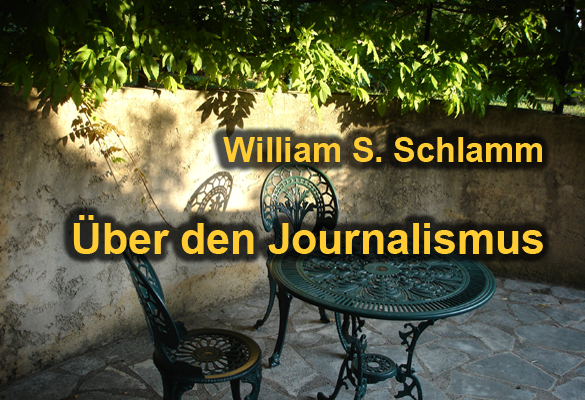
 uerst zu zweit, dann — nachdem wir drei weitere Stühle besorgt hatten — zu fünft hatten wir uns an einem Spätsommertag zum Aperitif im Kleinen Café getroffen. Wir berieten die Getränke und begannen dann die neuesten journalistischen Gerüchte zu diskutieren.
uerst zu zweit, dann — nachdem wir drei weitere Stühle besorgt hatten — zu fünft hatten wir uns an einem Spätsommertag zum Aperitif im Kleinen Café getroffen. Wir berieten die Getränke und begannen dann die neuesten journalistischen Gerüchte zu diskutieren.
Letztendlich landeten wir beim heutigen Journalismus im Allgemeinen.
Das Ansehen der Journalisten in der Gesellschaft ist niedrig, sie werden abschätzig betrachtet — und das schon fast solange, seit es Zeitungen gibt. Einer der am Tisch sitzenden Freunde erinnerte sich sogar an einen Ausspruch aus dem 19. Jahrhundert von Arthur Schopenhauer: „Eine große Menge schlechter Schriftsteller lebt allein von der Narrheit des Publikums, nichts lesen zu wollen, als was heute gedruckt ist: die Journalisten; treffend benannt: verdeutscht würde es heißen Tagelöhner.“ [Arthur Schopenhauer. Über Schriftstellerei und Stil. 1851.]
Er fuhr fort mit Karl Kraus’ Feldzug gegen die Presse; Kraus sprach von „Journaille“, „Tintenstrolchen“, „Fanghunde der öffentlichen Meinung“, „Corruptionspresse“, „Preßmaffia“, „Preßköter“. Diese Bezeichnungen ziehen sich durch sein gesamtes Lebenswerk. Er wirft der Journaille vor, dass „bloß das, was zwischen den Zeilen steht, nicht bezahlt“ sei.
Das Phänomen sei nicht neu und erstrecke sich auch auf weitere Kontrolleure der öffentlichen Dinge und Meinungen: dass alles der Kritik durch die Presse ausgesetzt ist — mit Ausnahme der Presse selbst. Er verwies auf die Zahlung sogenannter „Pauschalien“ an Zeitungen, mit denen sich große Wirtschaftsunternehmen das Wohlverhalten dieser Zeitungen erkauften — und konnte einen Zusammenhang zwischen Angriffen einer Zeitung auf ein Unternehmen und deren Erlöschen nach der Schaltung einiger Inserate dieses Unternehmens belegen.
Sein Tischnachbar meinte, dass das doch jeder wisse. Und er ergänzte: „Sie sind träge, manchmal feige, und sie kennen die Fakten nicht. Wahrscheinlich lernen sie das auf ihren Journalistenschulen, die wahrscheinlich wegen des minderwertigen Schulwesens wie Spargel aus dem Boden schießen — dort lernen sie lesen, schreiben, rechnen, dem politischen Trend folgen und nett zu Politikern und Bankern zu sein. Heute schreiben sie für eine linke Zeitung, morgen für eine rechte Zeitung — für rote, grüne und natürlich auch bunte Publikationen. Anything goes — alles ist möglich.“
Jemand am Tisch räusperte sich. „Das klingt alles wie Stammtischgerede. Vielleicht sollten wir auf den Boden fundierter Argumentation zurückkehren.“
Und er fügte hinzu: „Ich erinnere mich an einen Aufsatz zu diesem Thema von William S. Schlamm, in dem auch er Karl Kraus erwähnte. Vielleicht kann ich ihn finden.“
Er fand ihn …

William S. Schlamm (urspünglich Wilhelm Siegmund Schlamm; 1904–1978) entstammte einer jüdische Familie der oberen Mittelschicht in Przemyśl, Galizien (Österreich-Ungarn). Schon früh wurde er Kommunist. Im Alter von 16 Jahren wurde er nach Moskau eingeladen, um Wladimir Lenin zu treffen. 1929 verließ er die Kommunistische Partei und wurde 1932 Mitarbeiter der Zeitschrift „Die Weltbühne“.
1938 emigrierte Schlamm nach New York, wo es ihm rasch gelang, als Journalist und Autor Fuß zu fassen. Er begann, für führende Medien wie die „New York Times“ und CBS-Radio zu arbeiten, ehe er 1941 in Henry R. Luces Medienunternehmen „Time Inc.“, das die großen Magazine „Time“, „Life“ und „Fortune“ im Portfolio führte, angestellt wurde und 1943 zu einem persönlichen Assistenten von Luce aufstieg. In einem 1940 veröffentlichten Buch „This Second War of Independence“ warb Schlamm für ein unnachgiebiges Vorgehen gegen den NS-Staat, gegen eine Appeasement-Politik des Westens und für eine wehrhafte Demokratie; innere und äußere Feinde der Freiheit sollten mit repressiven Maßnahmen und notfalls mit Waffengewalt bekämpft werden. Das Buch wurde zum Bestseller und etablierte Schlamm als anerkannten Publizisten in den USA. Die „New York Times“ lobte seine Gegenwartsdiagnostik. Er wurde 1944 US-Staatsbürger.
1957 unternahm Schlamm eine rund einjährige Deutschlandreise. Seine Beobachtungen motivierten ihn zu dem Buch „Die Grenzen des Wunders“ (1959), das mit über 100.000 verkauften Exemplaren zum Bestseller avancierte. 1972 zog er nach Deutschland, veröffentlichte die Zeitschrift „Die Zeitbühne“ und war einige Zeit lang Kolumnist für die Zeitung „Welt am Sonntag“. Er starb 1978 in Salzburg. →